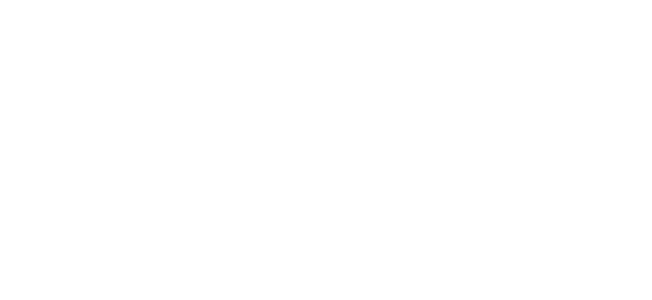Diese Rose ist keine Rose ist eine Rose
Vor einer Weile hat in meiner Gegend eine Weinbar eröffnet. Eine ziemlich gute Weinbar mit einem Schwerpunkt auf österreichischen Weinen, in der man gern nach Feierabend noch ein Gläschen trinkt und mit netten Menschen aus dem Viertel ins Gespräch kommt. Diese Weinbar, so dachte ich mir bereits bei meinem ersten Besuch, ist ein Ort, den ich in Zukunft gern noch öfter aufsuchen möchte, ein Ort, an dem ich mich nicht blamieren möchte. Und jäh glitten meine Gedanken in der Erinnerung zurück. Zurück in das Jahr 1996, zurück in eine andere Weinbar, in einer anderen Stadt. Zurück zu dem Gefühl der Scham, der Fremdscham und der Enttäuschung darüber, mit meinen Texten nichts Positives zu bewirken. Nur Hoffnungen zu zerstören – meine eigenen und die der Menschen in meinem Umfeld.
Auf die Idee, erstmals etwas selbst Erlebtes in eine Geschichte zu verwandeln, kam ich erst Jahre später, schätzungsweise 2003. Viel Selbstreflexion war nötig, viel ironische Distanz zu meinem damaligen Ich. Am Ende stand ein Text, der keinem früheren glich, den ich nie veröffentlichte und irgendwann vergaß. Bis jetzt.
Nach einem anstrengenden, (im Hauptberuf) arbeitsamen Januar freute ich mich darauf, mal wieder an einer Schreibnacht teilzunehmen. Eine andere Autorin rief wöchentlich unter dem Hashtag #freakyfridaynightwriters auf Instagram dazu auf, freitags ab 21 Uhr gemeinsam zu schreiben. Voraussetzung: Jede*r definiert ein individuelles Ziel und meldet am Ende, ob dieses erreicht wurde. Zwischendurch tauscht man sich aus – oder auch nicht. Oft liest man später durch die Beiträge der anderen, abonniert einander. Obwohl ich niemanden in der Gruppe persönlich kenne, webt da irgendwo ein Geist von Gemeinschaftlichkeit, der mir gut tut. Und da ich nach wochenlanger Schreibpause erst einmal wieder den Einstieg in mein Manuskript finden muss, beschloss ich, mich mit einem kürzeren Projekt in die Schreibnacht einzuklinken. Ich kündigte an, mein Dokument der Scham bearbeiten zu wollen.
Während der Arbeit merkte ich, dass es nicht reichte, Wörter und Sätze zu überarbeiten. Die Geschichte krankte an etwas anderem. Der Studentin passieren Dinge, das Verhalten der anderen erscheint ihr seltsam und beschämend. Sie selbst jedoch bleibt außerhalb der Ereignisse. Sie steht nicht wirklich über den Dingen, bleibt aber so passiv, wie ich mir damals in dieser Situation vermutlich vorkam. Aus einer Distanz von 22 Jahren sah ich nun, dass die Studentin genauso beschränkt und kleinkariert ist, wie alle anderen. Die Dinge sind ihr nicht einfach so passiert. Sie hat sie durch ihr eigenes unreifes Verhalten dazu beigetragen, sie herbeizuführen. Unabhängig von dem, was sich damals ereignet hat, wird die Geschichte als solche erst rund, wenn die Studentin aus ihrer Passivität tritt.
Und so bin ich in der Schreibnacht noch einen weiteren Schritt auf Distanz zu mir und dem Abend vor 22 Jahren gegangen und habe das ursprünglich peinliche Erlebnis in eine Geschichte verwandelt, die meinen geneigten Leser*innen hoffentlich das eine oder andere Schmunzeln entlockt.
Ich wünsche gute Unterhaltung mit:
Diese Rose ist keine Rose ist eine Rose
Der Mann und die Frau, die in wenigen Minuten in einer französischen Weinbar eine Plastikrose finden, sind kein Paar. Dies voranzuschicken ist ihr wichtig.
Er dagegen hält dieses Detail für so nebensächlich, wie die Farbe seiner Socken, von der, wer seine Zeit nicht sinnvoller zu gestalten weiß, gern selbst entscheiden soll, ob sie zu seinen Schuhen passt.
Sie ist eine Studentin im zwölften Semester, die Schriftstellerin sein will, er Gelegenheitsprogrammierer, der lieber Wissenschaftler wäre. Als gebürtiger Grieche weiß er, dass Philologe »Freund der Wörter« bedeutet. Er selbst liebt Wörter – und die Nähe zu Menschen, die mit Wörtern umgehen. Menschen wie die Studentin, die schon den vierten Roman unter dem dritten Pseudonym geschrieben hat, aber nicht veröffentlicht. Für sie sind Wörter ein Heer gesichtsloser Soldaten, die sie im Kampf um einen geraden Satz umherstößt, herumkommandiert, bei Ungehorsam bestraft. Sie spürt, wie sich die Wörter ihr widersetzen und Abgründe voller Selbstzweifel zwischen ihnen klaffen. Bangen Herzens hofft sie auf die Unterstützung von einem Freund der Wörter, der ihr das Heer gefügig redet, auf dass es ihrem Willen folgen möge. Für sie wird der Grieche zum Feldherrn auf dem Schlachtfeld der Sprache, was diesem mehr als schmeichelt. Gleichzeitig wächst sie in seinen Augen zu einem jungen Talent, das er im Begriff ist zu formen und zu entdecken, was ihr nach allen Zweifeln mehr als gut tut. Und so eint die Gabe, einander zu sehen, wie der andere gern gesehen würde, sie für einige Stunden zu einem Paar im Geiste, das abends bei einem Glas Wein über die Schönheit von Metaphern diskutiert und sich darüber freut, dass das Ambiente der französischen Bar so hervorragend zu ihrem Gefühl von Bohemien des 21. Jahrhunderts passt.
In der Tat ist die Kulisse perfekt: Licht kriecht an sandfarbenen Wänden zur Decke, und an einem halben Dutzend alter, mit Intarsien verzierter Holztische sitzen zumeist Paare, die sich tief in die Augen blicken, während ihre Weingläser dunkel klingen. Hinter der Bar arrangiert ein Kellner mit langer weißer Schürze fein geschnittenen Parmesan, Oliven und eingelegte Tomaten auf kleinen tönernen Tellern. In den Regalen hinter ihm fangen blank polierte Gläser und Karaffen Lichttropfen und aus versteckten Lautsprechern singt Edith Piaf »La vie en rose«.
Perfekt.
Nicht ganz.
Die Studentin ist gekommen, um etwas über ihr Talent zu hören. Doch ihr Begleiter, von dem ersten Glas Wein und seinen eigenen Worten berauscht, übt Kritik. Sie könne ja wirklich schön schreiben, nur fände sie nicht immer die richtigen Worte. So sei es eine Schande, die Augen einer attraktiven Frau mit Brunnenschächten zu vergleichen. Denn Schächte seien düster, leer, unwirtlich und entbehrten jeglicher Erotik. Die Studentin spürt die Kritik wie Hiebe und zieht den Kopf zwischen die Schultern.
Sie will über ihren Text reden, nicht über Erotik.
Dies ist der Moment, da ihr Blick über den Rand der Mappe mit den aufgefächerten Seiten ihres Manuskriptes schweift und dabei auf etwas fällt, das auf dem Boden zwischen dem Tresen und ihrem Nachbartisch liegt.
»Schau nur, eine Rose«, unterbricht sie den Monolog ihres Begleiters, der gerade angefangen hat, sich in der Rolle des Literaturkritikers wohl zu fühlen. Seine Ausführungen wegen einer Plastikblume zu unterbrechen, erscheint ihm trivial, ja unwürdig.
Doch er erkennt seine Chance.
Flink hebt er die Rose auf und fällt neben ihrem Tisch auf die Knie.
Die Studentin errötet. Obwohl sie davon träumt, berühmt zu sein, fürchtet sie sich davor aufzufallen. So überwältigt sie jetzt die Scham, während die Wut auf den Griechen, der sie aus ihrer Unscheinbarkeit zerrt, in ihr brodelt. Sie würde gern wegsehen, sein Theaterspiel an ihrer Seite ignorieren, aber es gelingt ihr nicht, zumal auch alle anderen Gäste der Bar zu ihnen hinübersehen und die Metamorphose des Literaturkritikers zum Poeten bezeugen. Immer noch auf den Knien streckt er ihr die Rose entgegen, deren Glanz es angeblich nicht mit dem Strahlen ihrer Augen aufzunehmen vermag, die Sterne sind, und er wünsche, die Nacht zu sein, die sie umschließe. Am Nachbartisch wird geklatscht, weiter hinten gelacht. Die Besungene zieht den griechischen Troubadour am Ärmel, damit er sich bloß schnell wieder hinsetzt und sie mit tief ins Gesicht gezogenen Haaren so tun kann, als sei nichts gewesen. Die Rose steckt sie in die Spirale ihres Notizblocks und schiebt widerwillig die handgeschriebenen Manuskriptseiten in die Blickrichtung ihres Begleiters. Lieber will sie seine Kritik an ihren Metaphern hören, als seine Schmeicheleien mit allen Anwesenden zu teilen.
Doch der Versuch, zurückzukriechen in das Gespräch unter zweien, misslingt.
Der Kellner kommt.
Ein Tablett balancierend, bewegt er sich elegant zwischen den eng stehenden Tischen, als seien sie Teil seines Tanzes. Mit einer galanten Handbewegung zupft er die Rose aus der Spiralbindung und schickt sich an, sie auf seinem Tablett fortzutragen.
»Monsieur«, ruft der Grieche eine Spur zu laut, worauf sich der Kellner mit einem bedauernden Lächeln in seine Richtung neigt.
»Die Rose«, erläutert er mit einem Akzent, der gar nicht französisch, sondern vielmehr italienisch klingt, gehöre dem Herrn dort drüben. Er nickt Richtung Bar, an der ein Kerl mit Jackett über dem Jeanshemd neben einer Frau mit Barbie-Dekolleté, üppigen braunen Locken und Leopardenrock sitzt, in deren Nähe er offenbar stark schwitzt, denn seine Brille ist ganz beschlagen. Der verkappte Student, Literaturkritiker und Poet ist empört. Es sei ja möglich, dass die Rose dem Herrn einmal gehört habe. Aber er habe sie aufgrund seiner Unachtsamkeit verloren, und er, der Grieche, habe sie gefunden und für eine romantische Liebeserklärung verwendet, wodurch die Rose erst einen Wert erhalten habe.
So erklärt er es dem Kellner und das müsse auch der Herr verstehen. Die Rose, betont er, sei bis zu dem Moment, da er sie aufgehoben hatte, eigentlich eine Nicht-Rose, ein billiges Plastikimitat, gewesen. Erst durch seine Handlung sei sie tatsächlich zu einer Rose geworden, dem Symbol der Liebe, seiner Liebe zu der Studentin, die übrigens Schriftstellerin sei und eines Tages berühmt sein werde, und der Kellner wolle doch sicher nicht riskieren, in dem Werk dieses jungen Talents unromantisch und kleinkariert dargestellt zu werden.
Das junge Talent möchte am liebsten zu dem Olivenkern werden, den Locken-Barbie gerade dezent unter den Tisch fallen lässt. Der Kellner lächelt entschuldigend und geht, um dem Herrn im Jackett die Rose zu überreichen. Der bedankt sich höflich, steckt sie in seine Jacketttasche und will sich gerade wieder seinem Wein zuwenden, als seine Begleiterin sich ihm entgegenneigt und etwas sagt, worauf er seine Brille an seinem Jackett abwischt und sich schließlich erhebt. Unsicheren Schrittes geht er auf den Tisch des Griechens und der Studentin zu.
Es sei nämlich so, erklärt er, dass die Rose einen hohen ideellen Wert für ihn habe. Er sei sehr verliebt in die junge Frau an seinem Tisch und heute seien sie auf dem Jahrmarkt am Schießstand gewesen. Dort habe er alle fünf Schüsse vertan, aber seine Freundin habe vier Mal getroffen und zwei Schraubenzieher und eben diese Rose gewonnen, die sie ihm geschenkt habe. Zum Beweis zieht er zwei Schraubenzieher mit rotem Kunststoffgriff ebenfalls aus der Jacketttasche, in der schon die Rose steckt, und hält sie dem Griechen unter die Nase.
Der fühlt sich bestätigt.
Sie seien also beide verliebt, stellt er fest. Der Jackettträger habe eine Liebeserklärung in Form eines Geschenks erhalten, und er, der Grieche, habe eine gemacht – zufälligerweise mit demselben Geschenk, aber das könne der andere doch leicht hinnehmen, zumal er ja noch die beiden Schraubenzieher habe. Die Brille des Jackettträgers beschlägt aufs Neue und lässt seine kleinen, blauen Augen im Nebel verschwinden. Auch er selbst hat das Gefühl im Nebel zu stehen. Der Wortnebel des anderen lässt ihn nicht erkennen, welche Richtung das Gespräch nehmen wird. Das verunsichert ihn, so dass er wiederholt, die Rose habe für ihn einen hohen ideellen Wert. Die Studentin, die inzwischen die Unmöglichkeit einer Verwandlung in einen Olivenkern anerkennt, sagt leise, es sei in Ordnung und man solle sich doch nicht um eine Plastikblume streiten, die billig und darüber hinaus auch noch kitschig sei.
Es gehe nicht um Kitsch, erwidert der Grieche, und er sei enttäuscht von ihr, ob denn seine Liebeserklärung nicht den Wert der Rose in ihren Augen gesteigert habe.
Sie beginnt sich zu rechtfertigen.
Der Brillenträger sieht plötzlich wieder klarer und nutzt die Gelegenheit, sich auf seinen Platz zurückzuziehen.
Der Grieche indes ist ernsthaft beleidigt. Wenn seine Begleiterin Romantik im wahren Leben nicht zu erkennen vermöge, dann sei es kein Wunder, dass es ihren Texten an Herz fehle.
Die junge Frau ist gereizt.
Sie habe niemals beabsichtigt, romantische Texte zu schreiben, das sei oberflächlich und keine Literatur, ihr ginge es um die Tiefe der Dinge.
Um die Tiefe von Brunnenschächten, fügt er hinzu und leert mit grimmigem Blick sein Weinglas.
Sie hat seine Bemerkung glücklicherweise überhört. Vom Wein fühlt auch sie sich inzwischen benebelt, und die Vorwürfe, die sie ihrem Begleiter jetzt im Sekundentakt an den Kopf wirft, prasseln wirr auf ihn ein, ohne jede Dramaturgie, laufen aber alle darauf hinaus, dass er dem Kellner niemals hätte sagen dürfen, sie sei eine Schriftstellerin.
Sie fühle sich auf diese Weise unter Druck gesetzt und aus ihrer Anonymität gerissen. Sie könne nicht schreiben, wenn sie fürchten müsse, überall in den Bars der Stadt Menschen zu treffen, die nach dem Erfolg ihrer Texte fragten.
Der Grieche versteht nicht, warum sie aus ihrem Schreiben ein Geheimnis machen will, nachdem er doch soeben das Geheimnis seiner Gefühle offenbart hat. Er will nachfragen, aber in diesem Moment kommt der Kellner wieder vorbei und stellt mit einer ähnlich galanten Bewegung wie der, mit der er die Rose mitgenommen hat, eine neue Karaffe Wein auf den Tisch.
»Von dem Herrn mit der Rose«, bemerkt er knapp.
Die Studentin fängt plötzlich an zu kichern und kann nicht mehr aufhören, auch nicht, als der Grieche, durch das unerwartete Geschenk rührselig geworden, anfängt, sich wortreich zu bedanken.
Dies sei das erste Mal, dass ihm jemand ein Getränk ausgebe, er fühle sich geehrt und gerührt und gleichzeitig untröstlich, da er ausgerechnet heute die freundliche Offerte nicht annehmen könne, denn er und die talentierte junge Schriftstellerin an seiner Seite hätten schon genug getrunken, so dass jeder weitere Schluck ein Risiko für ihre sichere Heimfahrt darstelle.
Es sei denn, der spendable Herr würde im Anschluss den Chauffeur geben.
Die Studentin hört jäh auf zu kichern. Auch dem Herrn im Jackett ist nicht wohl.
Der Kellner drückt einen Schalter neben der Bar und lässt das Deckenlicht erstrahlen, ein unmissverständliches Zeichen dafür, dass es bereits nach Mitternacht ist. Dem Griechen jedoch, der sich schon auf einer Bühne wähnt, kommt das Scheinwerferlicht gelegen. Er spricht von Gesten der Freundschaft und gegenseitiger Verantwortung und dass er Verantwortung trage für ein unentdecktes Talent und wenn er nach einer weiteren Karaffe Wein mit dem Talent im Auto von der Brücke stürzte, dann würde das Talent womöglich nie entdeckt, und alle wären unglücklich.
Der Kellner dreht die Musik lauter. Wieder erklingt »La vie en rose«, als wäre den ganzen Abend nichts anderes gelaufen.
Die Studentin versucht, ruhig zu atmen. Um jeden Preis will sie eine Fortsetzung der Diskussion um den Wert einer Nicht-Rose verhindern, und doch ist sie es, die schließlich den Plot um eine weitere Szene verlängert.
Man könne den Wein doch mitnehmen, schlägt sie vor, als der Herr im Jackett bereits seine Großzügigkeit bereut und der Kellner anfängt, mit einem Besen Olivenkerne unter den bereits verlassenen Tischen aufzukehren.
Der Grieche fährt herum.
Er liebt seine Begleiterin für ihre Einfälle, ihre spontanen Äußerungen, die eine Situation in reinster Klarheit oder geheimnisvollster Mystik erscheinen lassen, und dass sie gerade jetzt mit einem solchen Einfall kommt, da er nicht anders kann, als ein Geschenk abzulehnen, dass sie ihm geradezu zur Hilfe kommt mit ihrem Einfall, darin sieht er bereits eine Erwiderung seiner Liebe.
Er ist gerührt.
Ja, auch er will den Wein mitnehmen. Schon fasst er die Karaffe am Henkel, zieht einen Geldschein aus der Hosentasche und wedelt damit dem Italiener.
Doch der fegt weiter und erklärt nur trocken, die Karaffe sei nicht zum Mitnehmen.
Der Gast kann es nicht glauben.
Er werde die Karaffe selbstverständlich am nächsten Tag zurückbringen, so etwas verstünde sich unter Gentlemen von selbst.
Doch der Italiener schüttelt den Kopf.
Es dürften generell keine Karaffen aus der Bar mitgenommen werden und er könne da leider keine Ausnahme machen, erklärt er.
Der Brillenträger und seine Begleiterin haben inzwischen einen 50-Euro-Schein unter ihren Teller geklemmt, dessen Präsenz den Italiener daran erinnern soll, das Wechselgeld herauszugeben.
Doch der hat andere Sorgen.
Nun appelliert der schwierige Gast an die südländische Mentalität und beschwört die antike Verbrüderung von Römern und Griechen.
Es könne nicht sein, dass zwei Völker, die einst denselben Göttern huldigten, kein Vertrauen mehr ineinander hätten, wenn es um die Rückgabe eines einfachen Gebrauchsgeschirrs ginge.
Dem Griechen treten Schweißperlen auf Stirn und Oberlippe.
Seine Stimme wird laut, der Italiener zunehmend verunsichert.
Die Bar und mit ihr das Inventar und sämtliches Geschirr gehöre seinem Bruder, erklärt er.
Die Studentin glaubt zu verstehen, dass der Italiener lieber nicht für seinen Bruder arbeiten würde und sich den ganzen Abend lang bis zu diesem Augenblick vorgestellt hat, er sei der Patron, der Maître, der die Stammgäste begrüßt und den Wein des Hauses empfiehlt. Bis dieser Grieche eine Entscheidung von ihm fordert, die seine Befugnisse übersteigt und ihm am Ende des Tages noch einmal vor Augen führt, dass er es tatsächlich nur zum Kellner in der Bar seines Bruders gebracht hat.
Nein, auch der Bruder sei dagegen, dem Gast die Karaffe mitzugeben, teilt er mit. Wenn noch mehr Gäste auf diese Idee kämen. Man sei ja hier kein Take-Away. Und der Eindruck erst, wenn er am folgenden Abend in die gut besuchte Bar käme und seine Karaffe auf den Tresen stellte.
Nein.
Locken-Barbie wedelt mit dem Geldschein.
Ihr Begleiter grinst hinter seiner Brille.
Die Studentin starrt auf die zusammengekehrten Olivenkerne.
Der Grieche starrt in die olivenkernfarbigen Augen des Italieners. Das ist gar kein Italiener, denkt er, das ist der deutscheste aller deutschen Spießer, der ihm je in einer französischen Bar untergekommen ist.
Laut fragt er, ob er sich denn nicht emanzipieren könne. Ein Mann, ein Wille, eine Tat. Hinter dem Rücken des Bruders eine Karaffe Wein aus dem Laden verschwinden zu lassen, sei er dazu nicht Manns genug?
Dem Italiener schießt das Blut in den Kopf.
Stärker als je zuvor ärgert er sich darüber, dass nicht er der Herr dieses Ladens ist, dass er sich Regeln fügen muss, die sein Bruder aufgestellt hat. Immer freundlich. Niemals laut werden. Keine Schlägerei in der Bar. Er reißt der Frau an der Bar den Geldschein aus der Hand und kippt aus seiner großen schwarzen Geldbörse scheppernd zwei Handvoll Münzen auf den Tresen, aus denen er das Wechselgeld zusammenzählt.
Die Studentin bemerkt die geballten Fäuste ihres Begleiters. Den Zorn in seinen Augen. Sie fühlt seine Enttäuschung. Den ganzen Abend hat er sich auf die einfachen Dinge im Leben konzentriert: den Wein, den Käse, zwei Sätze aus dem Manuskript der Studentin, eine Rose, die nur aus Plastik ist, aber viel mehr symbolisieren kann. Diese kleinen Dinge haben ihn an sein Land erinnert, das er vermisst, und ihn die komplizierten großen Dinge vergessen lassen. Wie etwa die Angst. Die Angst, als Versager in seine Heimat zurückzukehren, als jemand, der stets als brillant gepriesen doch keinen Abschluss zustande gebracht hat, keine Familie gegründet und kein Haus gebaut hat. Nach einer unbeantworteten Liebeserklärung und deutlich zu viel Wein, zerrt dieser unsägliche Italiener die großen Dinge hinter den kleinen hervor. Die Frage von Besitz und Verlust hinter einer Plastikblume, Gehorsam und die Abhängigkeit von anderen Menschen hinter einer Weinkaraffe.
Die Frau mit den Locken hat jetzt ihr Wechselgeld, aber sie bleibt trotzdem sitzen, den neugierig und beschwipsten Blick auf den Tisch am Fenster gerichtet. Die Studentin sieht den Italiener mit der Rechnung auf ihren Tisch zustürmen, wo es zum unvermeidlichen Zusammenstoß mit dem Griechen kommen muss, der so hastig aufspringt, dass sein Stuhl rücklings gegen das Fensterbrett kippt.
Die Studentin hält die Luft an.
In ihren vom Wein weichgespülten Geist zieht plötzlich eine Erkenntnis ein, die ihr groß und herrlich vorkommt. Auf einmal weiß sie, dass das gesichtslose Heer, das Seite für Seite im Stechschritt durch ihr Manuskript marschiert, keine Macht hat. Sie weiß, dass es nichts bewegen und nichts verhindern wird. Aber sie selbst, sie kann etwas tun. Mit ein paar Worten kann sie die Tragödie in ein Happy End verwandeln und diese Erkenntnis lässt sie zum ersten Mal an diesem Abend lachen.
»Wir könnten den Wein in eine leere Flasche umfüllen.«
Ihre Stimme klingt fragend, aber der Italiener hört sie sofort. Augenblicklich ist er froh, seinem Bruder keine Schande gemacht zu haben.
Natürlich, eine leere Flasche! Warum ist er nicht selbst darauf gekommen?
Er nimmt die Karaffe, läuft zurück hinter die Bar, sucht eine besonders edle Flasche mit Siegel und gießt den Wein über dem Spülbecken um.
Für ihn ist der Abend gerettet.
Er findet sogar seinen Humor wieder und zwinkert der Studentin zu. Wenn sie ihr Buch herausgebracht habe, wolle er ein Exemplar mit persönlicher Widmung, ruft er und das Lächeln der Studentin erlischt wie die Kerze, die das Paar mit der Rose auspustet, bevor es nun endlich die Bar verlässt und an der Tür noch einmal winkt.
Der Grieche jedoch ist unzufrieden.
Er hätte die Karaffe ganz gewiss zurückgebracht.
Auf Wunsch sogar zu einer vereinbarten Uhrzeit an einen vereinbarten anderen Ort.
Die Studentin schiebt ihn sanft zur Tür, während er noch den letzten Cent seines Wechselgeldes einstreicht.
Sie wünscht dem Italiener eine gute Nacht und schwenkt zum Abschied die halbvolle Weinflasche. Ihr Begleiter murrt. Südländer sollten zusammenhalten.
Ein Stück weiter vorn auf der Straße geht das Paar aus der Bar. Die Frau lacht schrill, ihre Absätze klappern auf dem nassen Pflaster. Im nächsten Augenblick zieht der Mann sie an sich. Sie umarmen und küssen sich. Ihre Frisur gerät durcheinander, seine Brille beschlägt wieder, ihr Leopardenrock gleitet ihren Schenkel hinauf, sein Jackett verrutscht, als sich ihre Hände darunter schieben. Aus der Brusttasche fällt etwas heraus, das aussieht wie eine Rose. Auch etwas Metallisches mit rotem Plastikgriff kullert in den Rinnstein, ohne dass die beiden es bemerken. Zu wild sind ihre Küsse, zu gierig ihre Hände.
Die Studentin lacht und gleichzeitig kommen ihr die Tränen. Einige Meter vor ihr läuft der Grieche. Den Kopf gesenkt, die Schultern hochgezogen, die halbvolle Weinflasche in der Hand, sieht er weder das Paar noch die Studentin, die hinter ihm zurückbleibt und den Stapel dicht beschriebener Manuskriptseiten mit beiden Händen an sich drückt. Sie bereut, sie dem Griechen gezeigt zu haben. Sie bereut, sie geschrieben zu haben. Sie bereut, jemals etwas geschrieben zu haben, jemals geglaubt zu haben, sie hätte Talent. Sie hasst den Griechen, der von ihrem Talent gefaselt und doch jeden einzelnen ihrer Sätze zerpflückt hat. Sie will ihn bestrafen, will ihm die Konsequenz seiner Rede vor Augen führen. Er soll sehen, was er mit seinen Worten angerichtet hat.
Auf der Brücke beugt sie sich über das Geländer. Der Wind wird die Seiten aufwirbeln, weiß werden sie durch die Nacht tanzen, wie unbeschrieben, und dem entsetzten Griechen eine Lektion erteilen. Doch als sie die Blätter loslässt, scheint der Wind seinen Atem angehalten zu haben. Der Stapel stürzt lautlos in die Tiefe und als die Studentin mit zusammengekniffenen Augen in den dunklen Strom hinabspäht, entdeckt sie keine Spur mehr ihres Schaffens. Die Erkenntnis tröstet die Studentin und trocknet ihre Tränen.
Sie beschleunigt ihren Schritt und schließt auf zu dem Griechen, der schon fast auf der anderen Seite der Brücke angekommen ist. Sein Blick ist düster.
Sie müsse ihm verzeihen, sagt er leise, die Stirn in Furchen. Er habe sich blamiert. Noch nie sei er mit einer halbvollen Weinflasche aus einer Bar nach Hause gegangen.
————
Wer wissen möchte, was ich sonst so für kürzere Geschichten schreibe, kann „Das Echo der Farben“ jetzt bestellen:
Von Alizée Korte | Datum: 07.03.2018