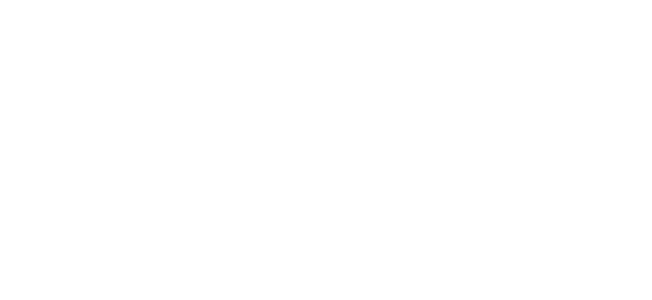Wie Sensitivity Reading meinen Roman veränderte
17. Juni 2020 – Die Frage beschäftigte mich in den vergangenen Monaten immer wieder: Sollte ich für meinen neuen Roman ein Sensitivity Reading vornehmen lassen? Beim Sesitivity Reading ist es bekanntlich so, dass eine zu einer marginalisierten Gruppe gehörende Person prüft, ob ein Text unterschwellig diskriminierend ist. Weil er Vorurteile zementiert oder auf Betroffene verletzend wirkt.
Die Crux mit den Details
In meinem aktuellen Roman sind meine Protagonisten Vika und Etienne als frisch verliebtes Paar zusammen. Die beiden nähern sich einander – auf unterschiedlichen Ebenen. Die Entwicklung ihrer Beziehung ist (ein) zentrales Thema des Romans. Dabei spielt natürlich auch Etiennes Querschnittlähmung eine Rolle. Wie viele (medizinische) Details sind in diesem Kontext nötig? Wo muss ich erklären, wo darf ich schweigen? Wie transportiere ich Stimmung, wo drohe ich sie mit ein, zwei Worten zu ruinieren?
Der Auftrag
Ich will nicht uninformiert wirken, aber noch weniger möchte ich Menschen verletzen. Der Zufall und die Sozialen Medien kamen mir schließlich zu Hilfe. Schon länger folge ich auf Twitter Alexandra Koch vom Buchblog The Read Pack. Von ihr wusste ich, dass sie Sensitivity Reading anbietet. Allerdings traute ich mich lange nicht, sie zu fragen, ob sie meinen Roman lesen würde. Schließlich wurde Alexandra schon vom ZEITmagazin interviewt. Ihr Anspruch an Literatur ist durchaus etwas höher und ich hatte meine Zweifel, dass ich ihm genügen würde. Irgendwann überwand ich dann doch meine Scheu. Schließlich würde es ihr freistehen abzulehnen und ich würde sie für das Sensitivity Reading natürlich bezahlen.
Sie sagte zu.
Paradoxe Betonung des Selbstverständlichen
Anfang des Monats begann die Zusammenarbeit, in deren Verlauf ich lernte, so manches Schreibmuster zu hinterfragen. Zum Beispiel: Wenn ich grundsätzlich anhand der Figur Etienne zeigen möchte, dass eine Behinderung EIN Persönlichkeitsmerkmal (von mehreren) ist, warum erwähne ich dieses eine dann überdurchschnittlich oft? Und zwar nicht nur in Szenen, in denen die Querschnittlähmung tatsächlich eine Rolle spielt, sondern auch immer wieder am Rande.
Verben der Bewegung. So schön.
Etienne ROLLT durch den Flur, PARKT am Esstisch, HIEVT sich auf das Sofa. »Muss das sein?«, fragte Alexandra. »Kann er nicht einfach ins Wohnzimmer KOMMEN, seinen Platz am Tisch EINNEHMEN und sich auf das Sofa SETZEN?« Dadurch, dass ich bestimmte Worte wähle, betone ich die Andersartigkeit – die ich eigentlich gar nicht hervorheben wollte.
Das heißt übrigens nicht, dass Etienne im fertigen Buch niemals mehr rollt, sondern dass es dort, wo er es tut, tatsächlich gewollt ist, dies zu betonen.
»Rollstuhlfahrer« oder »Mann im Rollstuhl«?
Neben den Verben knöpfte sich Alexandra auch die Substantive vor. Es kommt ja vor, dass man über Menschen schreibt, ohne ihren Namen zu nennen. Da überquert der Rollstuhlfahrer die Straße oder einige Querschnittgelähmte haben Schwierigkeiten mit ihrer Stabilität. Alexandra korrigierte »Rollstuhlfahrer« in »Mann im Rollstuhl« und »Querschnittgelähmte« in »Menschen mit einer Querschnittlähmung«. Mir sträubten sich die Haare.
Entscheidung mit Fingerspitzengefühl
Ich möchte ein gutes belletristisches Buch schreiben, keinen Sachtext in behördendeutschem Nominalstil! Hätte ich alle Änderungsvorschläge so akzeptiert, wäre mein Buch ein holpriges Textwerk geworden. Nun hätte ich als Autorin natürlich diese Vorschläge auch einfach ignorieren können. Mein Text, meine Entscheidung. So leicht habe ich es mir aber nicht gemacht. Denn hinter diesen Änderungsvorschlägen, so erklärte es mir Alexandra, verbarg sich das Anliegen, Menschen mit einer Behinderung als das vorzustellen, was sie in erster Linie sind: Menschen. Der Rollstuhl ist zweitrangig. In unserer Gesellschaft allerdings ist er oft das Erste, was wir wahrnehmen und viel zu häufig reduzieren wir den Menschen darin auf das Hilfsmittel. Dann macht die Bahn die Durchsage, dass noch »ein Rollstuhl« zusteigt und in einer fröhlichen Kindergruppe haben alle Namen oder personenbezogene Attribute außer »das Mädchen im Rollstuhl«, von dem wir nie erfahren werden, ob es frech ist, schlau, sportlich oder belesen. Ich habe Alexandras Anmerkungen daher weniger als Aufforderung verstanden, sperrig (aber korrekt) zu formulieren, sondern als Denkanstoß: Geht es in der jeweiligen Situation primär um den Menschen oder um die Besonderheit? So kann Vika feststellen: »Ich habe mich in einen Mann im Rollstuhl verliebt!« Und in einem anderen Zusammenhang kann Etienne sagen: »Ich bin Rollstuhlfahrer, ich möchte bitte ein barrierefreies Zimmer.«
Im Fall der »Querschnittgelähmten« habe ich übrigens komplett umformuliert. Der Satz, »Er gehört nicht zu den Querschnittgelähmten, die instabil sitzen«, war ohnehin nicht schön.
Diskriminierungsfrei beleidigen
Ein weiteres Thema, das Alexandra während des Sensitivity Readings angemerkt hat, war die Crux mit den diskriminierenden Beleidigungen.
Mein Roman ist modern und unterhaltsam. Die Figuren sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, also nicht immer politisch korrekt. Als mich also Alexandra erstmals darauf hinwies, dass man »Idiot« nicht schreiben sollte, weil es Menschen mit minderer Intelligenz oder einer psychischen Krankheit diskriminiert, dachte ich zunächst: Nö. Mein Buch. Mein Schreibstil. Meine Freiheit. Nur weil ich ein Sensitivity Reading beauftrage, muss ich nicht jeden Änderungsvorschlag annehmen. Außerdem schreibe ich keinen Fantasyroman, wo es lustig wäre, wenn sich die Figuren mit Pilznamen beschimpfen. (»Hey, du fransiger Wulstling, verschwinde!« – »Nicht in diesem Ton, blutblättriger Hautkopf!«)
Was macht meinen Schreibstil aus?
Doch unterschwellig arbeitete es in mir. Die »Idioten«, »Deppen«, »Trottel« und »Psychos« in meinem Manuskript sind also so sehr »mein Stil«, dass ich mich unmöglich von ihnen trennen kann? Ich lasse mir unpassende Bilder korrigieren und ändere Figuren aufgrund berechtigter Kritik, aber die »Idioten« sind so essentiell, dass ich auf keinen Fall auf sie verzichten möchte und lieber das Vorurteil zementiere, dass weniger intelligente Menschen oder solche mit psychischen Krankheiten »nicht okay« sind? So wollte ich (vor mir selbst) eigentlich nicht dastehen. Also fing ich an, über diskriminierungsfreie Alternativen nachzudenken. Keine Pilznamen. Keine Kinderflüche. Ziemlich schnell war klar, dass eine Liste der Synonyme nicht wirklich weiterhilft. Wie auch schon bei der kontextuell angemessenen Bezeichnung von Menschen mit Behinderung liegt die Lösung nicht in der Suche-Ersetze-Funktion. Wäre ja auch zu schön, wenn es so einfach wäre. Aber, nein. Wenn man »Idiot« einfach durch »Mistkerl« ersetzt, stellt man fest, dass es oft unpassend wirkt. Es führt also kein Weg daran vorbei, sich jeden konkreten Fall anzusehen und zu überlegen, welche Alternative treffend wäre. Im optimalen Fall klingt es dann auch nicht bemüht, sondern passend. Mit einiger Mühe fischte ich achtundzwanzig »Idioten« aus meinem Manuskript.
Weg mit den »Idioten«!
Ich hatte mir nicht einmal vorgenommen, wirklich alle zu eliminieren. Aber als ich anfing, über die einzelnen Verwendungssituationen nachzudenken, ist mir klar geworden, dass »Idiot« ohnehin nicht der treffendste Begriff war. Abhängig vom Kontext konnte ich ihn ersetzen durch »Flachpfeife«, »Stalker«, »Fehlinkarnation«, »A …loch«, »Scheiß-, Mist-, Dreckskerl«, »Knalltüte«, »Niete«, »Wurst«, »Brechreizbeschleuniger« oder »Dissertationsdilettant«.
Fazit
Was ich aus dem Sensitivity Reading mitgenommen habe ist die Einsicht: Hinterfragen ist gut. Nachdenken lohnt sich. Mein Roman ist durch Alexandras Denkanstöße besser geworden. Hundertprozentig Sensitivity Reading Approved wird er aber wohl trotzdem nicht sein.